Citylogistik 2.0 ?
Herausforderung und Notwendigkeit für die Zukunft oder die Frage der Sinnhaftigkeit?
Ein zentraler Aspekt der Handels- und
KEP-Logistik ist die Belieferung von Innenstädten. Insbesondere in
Ballungsräumen ist die zuverlässige Versorgung der Bewohner eine immer größere
Herausforderung. Die Logistiker hierfür haben das Konsumentenverhalten ebenso
zu berücksichtigen wie Restriktionen für den Verkehr wie temporäre Fahrverbote
und Umweltzonen. Schon in den 90er
Jahren gab es erste Versuche und Unternehmungen mit neuen Konzepten zur
Bündelung des städtischen Wirtschaftsverkehrs, die sogenannte „City-Logistik“,
diesen Herausforderungen
entgegenzutreten. In diesem Zeitraum gab es auch eine kurze, öffentlich geförderte Blüte der
City-Logistik, um wenig später klanglos in der Versenkung zu verschwinden. Stadtteilreine
Zustelltouren bedingen die vorlaufende Konsolidierung aller Sendungen in einem
Terminal. Können solche Cityterminals von den Netzbetreibern in ihren
Hauptläufen nicht direkt angefahren werden, sind dafür zusätzliche Transporte
und ein weiterer Umschlag erforderlich. Das erzeugt zusätzliche Kosten. Die
Konzepte der 90er Jahre sind primär an der kritischen Masse gescheitert, die
nötig ist, um solche Mehrkosten durch Effizienzgewinne auf der letzten Meile
wieder hereinzuholen.
Jetzt haben sich
wesentliche Rahmenbedingungen geändert bzw. verschärft: In Zukunft werden 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben
und potenzieren somit alle damit
zusammenhängende Mobilitäts- und Umweltprobleme, E-Commerce mit den
ganzen logistischen Herausforderungen ist auf dem Vormarsch. Ziel ist es daher,
neue, umweltfreundliche und effektive Konzepte zur Versorgung der Ballungsräume
zu entwickeln. Die Citylogistik erlebt somit heutzutage eine Renaissance.
Es gibt aber auch Stimmen und Meinungen,
die eine neue Initiative in Richtung Citylogistik 2.0 kritisch sehen oder gar
ablehnen. Die Argumentation ist, dass der städtische Wirtschaftsverkehr nicht
zwangsläufig daran schuld ist, dass Staus in Innenstädten in den vergangenen
Jahren zugenommen haben. Der innerstädtische Wirtschaftsverkehr hat sich seit
den 90er Jahren sehr effizient verbessert. So haben die großen Handelsorganisationen
außerhalb der Innenstädte Verteilzentren errichtet. Mit nur wenigen Stopps
versorgen sie mit oft kleinen Nutzfahrzeugen die Filialen. Signifikante
Verbesserungen werden durch gemeinsame Lager konkurrierender Logistiker nicht
gesehen. Vielmehr würde die Abstimmung zwischen den Unternehmen die Prozesse
deutlich komplizierter machen. Auch im Bereich der KEP-Dienstleiter werden
keine großen Effizienzgewinne gesehen, da die meisten Touren hier schon
weitgehend optimiert sind.
Letztendlich geht es darum, durch
Bündelung, Zusammenlegung und Kooperationen, die Sendungen pro Stopp sowie die
Stopps pro Tour insgesamt zu maximieren. Andererseits verfügen die großen
Handelsketten und Logistiker bereits über ihre eigenen optimierten
Logistiksysteme. Warum sollten sie jetzt also kooperieren? Mehr oder weniger
funktioniert momentan noch alles.
Dennoch haben die Akteure am Markt die
Intention, auf neue Entwicklungen eingestellt zu sein und hierfür auch Konzepte
bereits mitentwickelt zu haben. Die Frage nach dem „Carbon Footprint“ wird
inzwischen auch von den Kunden der Transportunternehmen und Warenverteilzentren
gestellt und wird zunehmend eine Wettbewerbskomponente: nicht nur die
betriebswirtschaftliche, sondern die gesamtwirtschaftliche Optimierung spielt
zunehmend eine Rolle. Citylogistik wird in dieser Hinsicht als ein wichtiges
Zukunftsthema angesehen, das es jetzt bereits anzupacken gilt, und dies beim
Handel, Logistikern und auch bei den Behörden. Denn Themen wie Emissionen oder
Lärm stehen weit oben auf der Agenda, nicht nur bei der EU in Brüssel
Das neue City-Logistik-Konzept in den
Niederlanden, „binnenstadservice.nl“, ist ein Beispiel dafür, wie solche
Konzepte erfolgreich umgesetzt werden können. Dabei ist das Grundmuster von
„binnenstadservice.nl“ nicht neu: Von einem Zentrallager aus erfolgt die
Belieferung des Einzelhandels in der Innenstadt. Für die Lieferanten ist damit
dieser Knotenpunkt die alleinige Lieferadresse. Auf diese Weise wird eine
deutliche Verringerung der LKW-Fahrten in die Innenstadt erreicht.

Quelle: http://www.binnenstadservice.nl/
Eher
wissenschaftlich basiert ist das Projekt „Urban Retail
Logistics“ des Effizienzclusters Logistik Ruhr. Hier wird zum
Beispiel einen händlerübergreifenden Ansatz zur Entwicklung
von Kooperationen verfolgt und erforscht.
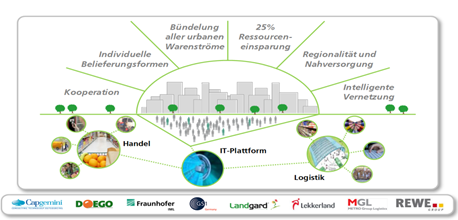
Quelle: http://www.urbanretaillogistics.de
In dem aktuell von TCI bearbeiteten Projekt
“Erstellung eines Regionalen Logistikkonzeptes Köln“ spielen solche
Überlegungen natürlich auch eine wichtige Rolle. Es sind aussagekräftige
Performance-Indikatoren entwickelt worden, die mithelfen, Lieferkonzepte in
Städten und Ballungsräumen zu verbessern.
Ein wichtiger Erfolgsfaktor wird sein, dass
alle Konzepte auf betriebswirtschaftlicher Ebene bei den Akteuren eine
überzeugendere Kosten-Nutzen-Bilanz aufweisen müssen, dies sich aber auch
gesamtwirtschaftlich rechnet. Vor allem, wenn man im Gegensatz zu den
Pilotprojekten der 90er Jahre externe Effekte wie geringere Schadstoffemissionen
und verbesserte Mobilität in die Kalkulation einbezieht und sich auf hinreichend
große Städte konzentriert, ist dies auf jeden Fall realistisch sein.
|